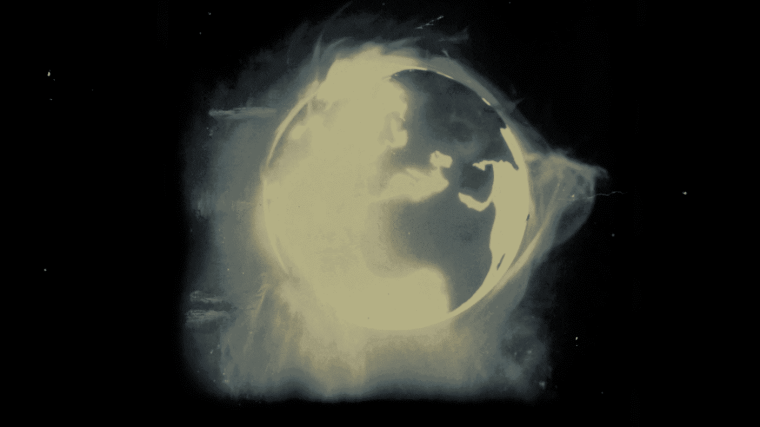
Meldung vom:
Im Jahr 2000 schlugen die Wissenschaftler P. Crutzen und E.F. Stoermer vor, eine neue sog. geochronologische Epoche auszurufen: Das "Anthropozän" sollte beschreiben, dass der Mensch zum wesentlichen Faktor der Erdentwicklung geworden ist. Nach langjähriger Prüfung wurde der Begriff von der internationalen geochronologischen Gesellschaft ICS 2024 als Bestimmung einer neuen Epoche abgelehnt. Diese Ablehnung hat der weltweiten Konjunktur des Begriffs in den letzten 20 Jahren aber keinen Abbruch getan.
Der Begriff des Anthropozän wird seit einigen Jahren zunehmend auch in der internationalen Filmwissenschaft diskutiert. In der Vorlesung geht es uns zum einen darum, diese Diskussion darzustellen und mit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, um das Phänomen zu verknüpfen. Zum anderen fragen wir danach, wie aktuelle und historische Filme das Verhältnis von Mensch und Natur denken und welche spezifischen audiovisuellen Ästhetiken sie entwickeln, um dieses Verhältnis darzustellen. Wir gehen davon aus, dass sich das Kino als eine der grundlegenden Praktiken sozialer Imagination im 20. und 21. Jahrhundert bestimmen lässt, die unser gesellschaftliches Verhältnis zur Natur und zu den Veränderungsprozessen in der Natur (mit)prägt. Zudem gehen wir davon aus, dass die verschiedenen, im Lauf der Kinogeschichte entwickelten Konzeptionalisierungen des Verhältnisses Mensch-Natur aufeinander aufbauen und in ihrer Dynamik verstanden werden müssen, um die aktuellen Filme, die das Anthropozän unmittelbar thematisieren, mit- und nachvollziehen zu können.
Einerseits werden wir Spiel- und Dokumentarfilme (aus Perspektive des globalen Nordens und Südens) analysieren und diskutieren, die sich direkt mit Themen des Anthropozäns, etwa dem Klimawandel oder dem Artensterben beschäftigen. Dazu werden wir auch Expert/innen einladen. Dann wollen wir aber auch Beispiele aus Filmgenres einbeziehen, die seit je insbesondere das Verhältnis von Mensch und Natur thematisieren, so etwa der Western oder der Katastrophenfilm. Schließlich werden wir, zumindest am Rande, auch den Experimentalfilm berücksichtigen, weil hier die eingespielten Wahrnehmungsweisen von Natur auf formaler Ebene reflektiert und alternative Formen ausprobiert werden.
Jede Sitzung der Vorlesung, die im Kino im Schillerhof (Jena) stattfindet, besteht aus einer Einführung, einer Filmvorführung und einer anschließenden Vorlesung mit Diskussion; sie dauern je nach Filmlänge drei bis vier Zeitstunden. Beginn ist am 14.10.25 im Kino im Schillerhof in Jena.
Die Vorlesung wird mit einem Testat am 3.2.2026 abgeschlossen.