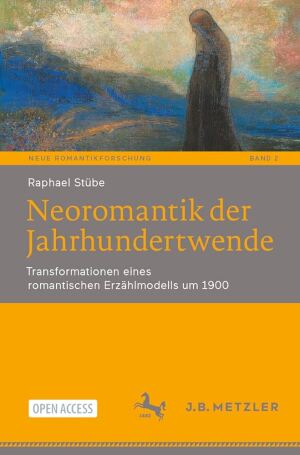Meldung vom:
Raphael Stübe
Foto: PrivatLieber Herr Stübe, Ihre Dissertation ist mit dem Novalis-Preis 2025 ausgezeichnet worden. Auf welche Weise ist das Erkenntnisinteresse an der Literatur der Romantik bei Ihnen erwacht?
Ich erinnere mich an eine Zugfahrt, auf der ich zum ersten Mal die kleine Erzählung „Der blonde Eckbert“ von Ludwig Tieck gelesen habe. Das war im Zuge eines Proseminars („Prosa der Romantik“, WS 2010/11) an der Universität Münster, das von Christoph Kleinschmidt geleitet wurde. Ich hatte kaum Vorkenntnisse und wurde von Tieck völlig überrascht: Das zuerst beschauliche ‚Volksmärchen‘ entwickelte sich während meiner Zugfahrt zu einem psychologischen Horrorschocker, womit ich – durchaus im Sinne Tiecks – nicht gerechnet hatte. Es war aber auch ein gewisser Pulp-Effekt, der mich für diese Literatur einnahm: Das war anspruchsvoll, ohne elitär aufzutreten. Es erinnerte mich an Superheldencomics, die ich gerne las; an Kinofilme mit überraschenden Wendungen (z.B. „The Sixth Sense“); kurzum: an Dinge, mit denen ich Anfang zwanzig etwas anfangen konnte. Einen Großteil des Semesters verbrachte ich dann mit der Fischer-Taschenbuchausgabe von Novalis᾽ „Gesammelten Werken“ unter dem Arm, bei der sich notorisch die Seiten lösten.
Romantische Texte dieser Art besitzen ja ein gewisses Identifikationspotenzial …
… das ich heute etwas distanzierter betrachte. Sie empfehlen sich sehr unaufdringlich, können aber dazu führen, dass sich Menschen in offene Suchbewegungen stürzen – wohin auch immer die Reise gehen soll. Ich hatte das Glück, auf meinem Weg an insgesamt drei Standorten zu landen, die für die Romantik-Forschung bis heute zu den wichtigsten zählen – erst Münster, dann Jena und schließlich Frankfurt am Main.
Wie kam es, dass die „Neoromantik“ zum Gegenstand Ihrer Untersuchung geworden ist?
Tatsächlich spielte das altbekannte Buch von Rüdiger Safranski dabei eine gewisse Rolle. Nach meinen Lektüreerfahrungen mit Tieck und Novalis leuchtete es mir nicht recht ein, dass die Romantik als „deutsche Affäre“ direkt in die kulturhistorische Katastrophe führen sollte. Trotzdem blieben Fragen: Wie konnte es sein, dass sich die Nationalsozialisten derart für die romantischen Bildwelten interessierten? Neben der Romantik las ich im Studium viel Thomas Mann, der – neben allen offensichtlichen Ähnlichkeiten im Schreiben – ja ebenfalls eine gewisse ‚romantische‘ Zeitstimmung für die Krisen des frühen 20. Jahrhunderts mitverantwortlich machte. Safranskis Thesen schienen mir bald mehr mit der Kultur um 1900 zu tun zu haben als mit der historischen Romantik um 1800. Wichtig war auch, dass es in Münster bereits eine kleinere Forschungstradition zur Neoromantik gab – anschließend an Detlef Kremer hatten schon Claudia Lieb und Stefan Tetzlaff (als wohl einzige Stimmen in der jüngeren Forschungslandschaft) zu dem Begriff publiziert. Nachdem ich mich in meiner Abschlussarbeit zu „Ironie und Eigentlichkeit bei Christian Kracht“ ziemlich verausgabt hatte, suchte ich wieder nach einem historischen Thema, das in gewisser Hinsicht still hielt. Das traf auf die Neoromantik zu.Die Lücken der Forschung stießen sofort ins Auge, gleichzeitig wirkte der Begriff auf den ersten Blick sogar etwas verstaubt (vor allem in seiner zeitgenössischen Variante: der ‚Neuromantik‘). Ich schrieb ein Exposé ins Blaue hinein, das diesen Staub aufzuwirbeln versuchte – und dann war es ein unvorhersehbarer Glücksfall, dass ziemlich genau im Moment des fertigen Texts eine Stellenausschreibung aus Jena publiziert wurde, die nach Fortwirkungen des „Modells Romantik“ bis in die Gegenwart fragte. Mein Projekt passte so gut dazu, dass ich zugegebenermaßen kaum zweifelte, dass das Buch jetzt in Jena entstehen würde.
In welcher Weise bringen Ergebnisse Ihrer Arbeit die literaturwissenschaftliche Forschung voran? Was ist in methodischer Hinsicht für die Fachgeschichte der Germanistik wichtig?
Ich bin kein Anhänger einer Literaturwissenschaft, die literarische Texte durch ihre Analysen noch einmal komplizierter macht, als sie sind. Bitte nicht falsch verstehen: Literatur ist in aller Regel doppelbödig und überkomplex, das gehört zu ihrem Wesenskern und macht sie so reizvoll. Eine wissenschaftliche Analyse aber, die diese Komplexität nur kartographiert bzw. sie noch einmal verstärkt, bleibt meines Erachtens auf der Hälfte der Strecke stehen. In meinem Buch versuche ich, ein möglichst kohärentes Deutungsangebot zu formulieren, das andere Perspektiven nicht ausschließt, das aber immerhin einen Vorschlag macht, wie sich die Neoromantik auf dem gegenwärtigen Forschungsstand insgesamt charakterisieren lässt. Methodologisch ist das kein unproblematisches Unterfangen. Einerseits gibt es die Gefahr einer erdrückenden Detailfülle, die immer auch andere Sichtweisen nahelegt – und die sich heute, mithilfe von digitalen Methoden, deutlich breitflächiger überblicken lässt als noch vor wenigen Jahren. Und andererseits existiert eine gewisse Verführungskraft des eigenen Narrativs, das in seiner Eigendynamik zu Ausblendungen neigt. In meinem Buch votiere ich deshalb für eine Kombination aus historischer Diskursanalyse und jüngerer Modelltheorie: Sie soll es ermöglichen, eigene Thesen zu formulieren (Modelle), die sich aber radikal und unentwegt am historischen Material überprüfen lassen müssen (Diskurs). Dem Modell ist damit ein erkenntnistheoretischer Vorbehalt eingeschrieben, der zu größtmöglicher Transparenz verpflichtet und nicht davor zurückscheut, das eigene Modell zu verfeinern (oder gar zu verwerfen), sollten sich neue Erkenntnisse ergeben. Trotzdem formuliert es auf der Höhe des Forschungsstandes ein Angebot, das sich im Idealfall bewähren kann.
Was lässt sich mit Ihrer Dissertation von der Romantik als Phänomen lernen?
Zwei Erkenntnisse sind mir besonders wichtig: Zum einen lässt sich im Verlauf der Neoromantik beobachten, wie ein ursprünglich ästhetisches Phänomen ziemlich schnell zu einem kulturpolitischen Projekt umgemünzt wird. Aus der fragilen Nervenästhetik eines Hugo von Hofmannsthal wird die Romantik der Heimatkunst und des Wandervogels – und das durchaus aus einer anfänglichen ‚Wesensverwandtschaft‘ heraus. Ich skizziere das in meinem Buch mithilfe eines Pfeilmodells, das allmählich auseinanderdriftet: Aus dem gemeinsamen Interesse an romantischen Stoffen entwickeln sich zwei unterschiedliche Aneignungsweisen, bei denen die erste tiefer in die literarische Moderne ragt, die zweite jedoch moderne Komplexität unter Schlagworten wie ‚Gesundheit‘ und ‚Rasse‘ bekämpft. Bemerkenswert ist, dass in diesem Kulturkampf kurzfristig die antimoderne Schlagrichtung gewinnt: Sie schnappt sich den Begriff der Romantik für viele Jahrzehnte im Diskurs, und das gilt es für die Wirkungsgeschichte des Phänomens unbedingt zu bedenken. Kurz gefasst: Am Ende der Neoromantik ist auch die historische Romantik etwas anderes als an ihrem Anfang. Zweitens aber steckt auch etwas in dieser historischen Romantik, was sie für Vereinnahmungen dieser Art anfällig macht. Man sollte sie nicht vorschnell aus ihrer Verantwortung entlassen: An der Rezeptionsgeschichte beispielsweise von Novalis lässt sich idealtypisch studieren, wie seiner Literatur einerseits immer wieder Vielfalt und Denkoffenheit attestiert wurden, andererseits aber auch Bindungswünsche und Fortschrittskritik. Beide Optionen sind im Werk angelegt. Ich glaube, man versteht die literarische Romantik nur richtig, wenn man beide Seiten berücksichtigt: Romantische Literatur formuliert auch eine Kritik an der Moderne aus ihrer eigenen Logik heraus. Diese Ebene spielt in der gegenwärtigen Forschungslandschaft eher eine untergeordnete Rolle. Man könnte vielleicht sagen, Texte der Romantik simulieren Gefahren von Modernität, um einen emanzipierenden Umgang mit ihr zu ermöglichen.
Das Verständnis der historischen Romantik verändert sich geschichtlich. In welchem Verhältnis stehen wir heute zur Frühromantik (um 1800) bzw. zur Neoromantik (um 1900)?
Ihre Frage hat mehrere Ebenen. Grundsätzlich beobachte ich, dass wir wieder stärker in eine Phase der Romantik-Kritik eingetreten sind. Das betrifft vor allem unsere Alltagsdiskurse: Eine freie, manchmal ziellos wirkende Entfaltung unserer Individualität dürfte gesellschaftlich gerade eher kritisch betrachtet werden. Stattdessen fragen wir uns, wie wir eine (manchmal auch: lähmende) Multikomplexität bändigen können, wie wir uns verteidigen, wirtschaftlich produktiv werden, kurzum: wie wir uns von so manchen Träumereien verabschieden und wieder in Gang kommen. In beiden Romantiken, sowohl um 1800 als auch um 1900, brechen solche Diskussionen unübersehbar in ihrer Spätphase hervor. Auch heute dominiert das Gefühl, dass wir eher in einer sogenannten ‚Spätmoderne‘ feststecken (Hartmut Rosa, Andreas Reckwitz) – als dass sich ein euphorischer Aufbruch zu etwas Neuem wirklich durchsetzen könnte.
In welcher Weise können wir heute Distanz zu unserer eigenen Gegenwart gewinnen?
Genau dazu helfen, würde ich sagen, Kunst und Literatur aus vergangenen Epochen. Häufig lassen sich darin Probleme auffinden, die uns aus der Gegenwart lose bekannt vorkommen – um dann in einer anderen, manchmal überraschenden Weise bearbeitet zu werden. In der Neoromantik zum Beispiel hadern viele Akteure mit einem ausdifferenzierten Wissenssystem, zu dem sie nur noch als Spezialisten etwas beitragen können. Der Einzelne scheitert daran, das Ganze zu überblicken, ohne dabei wahnsinnig zu werden – das ist ein typisches Handlungsmodell in dieser Literatur. Ein Anliegen der Neoromantik ist es, noch einmal ‚Gefühle‘ für diese verlorene Universalität zu aktivieren. Manchmal wirkt das heillos reaktionär und kitschig, wie wenn Julius Hart ein „Hünengrab“ besingt. An anderen Stellen entwickeln sich jedoch Klagen über eine existenzielle Verlorenheit, die uns auch heute noch (oder wieder) beschäftigen, zum Beispiel bei Rilke: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?“ Hieraus lässt sich beispielsweise lernen, dass Kunst und Literatur auch als Ort fungieren können, um einen Druck der Spezialisierung abzufedern – und dass es bessere oder schlechtere Optionen gibt, gegen diese Vereinzelung anzuarbeiten. Dass so viele Leserinnen und Leser bis heute zu Hermann Hesse greifen, den vielleicht einflussreichsten Autor der Neoromantik, lässt ahnen, dass dieses Bedürfnis immer noch trägt.
Sie arbeiten bereits an einem neuen Buch, Ihrem Habilitationsprojekt. Worum geht es?
Tatsächlich knüpft das neue Buch mit dem Titel: „Entweder/Oder. Entscheidungskrisen im Vormärz“ an die hier umkreisten Gegenwartsprobleme an. Es erkundet in doppelter Hinsicht einen Grenzbereich der Romantik: Einerseits interessieren mich literarische ‚Entscheidungen‘ als ein Textphänomen, das Komplexität mutwillig abschneidet (bzw. ent-scheidet) und somit zu einem zentralen Paradigma modernistischer Ästhetik in kritischer Spannung steht. Eine allzu ‚entschlossene‘ Literatur, kurz gefasst, müsste auch die Ambivalenzen der Romantik beenden. Andererseits finden sich besonders vielfältige und brüchige Entscheidungsszenen vor allem in einer Spätphase der historischen Romantik, nämlich: in den 1830er und 1840er Jahren. Die Forschung spricht hier bereits von einer politisierten Vormärz-Epoche, die gleichzeitig unübersehbare Züge des ‚Biedermeier‘ trägt.
Mein Buch möchte vorführen: In Szenen des Entscheidens denken die literarischen Texte selbst über ihre Positionierung in diesem Epochenkonflikt zwischen Restauration und Revolution nach. Unterschwellig hat das viel mit unserer Gegenwart zu tun, da auch die Vormärz-Generation von dem Bewusstsein geprägt ist, sich in einer Krisenphase bzw. ‚Zeitenwende‘ (Gutzkow) zu befinden. Unter einem Diskursdruck zur Operativität evaluiert sie in (teils: heftigen) Entscheidungskrisen, wie man sich überhaupt positionieren kann, um eine Zerrissenheit des modernen Individuums in eine ideelle Entschlossenheit zu überführen, die „trotz alledem“ nicht unterkomplex wird (Freiligrath). Somit kartographiert das Projekt eine Epochensignatur der krisengeschüttelten Übergangsphase zwischen Julirevolution und 1848, um zugleich Verbindungslinien zwischen unerwarteten Akteuren aufzuzeigen – beispielsweise zwischen Heinrich Heine und Eduard Mörike, die sich in ihrer Entscheidungskritik verblüffend ähnlich sind.
Haben Sie vielen Dank für das Gespräch!