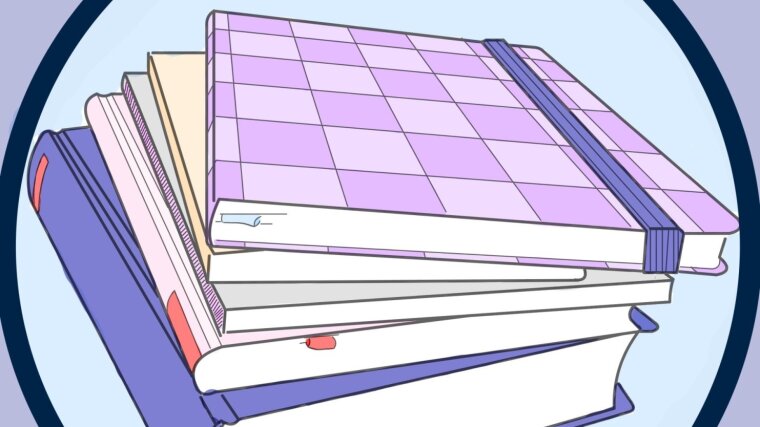
Buchrezensionen
-
„Ein Raum zum Schreiben“ von Kristin Valla
Mehr erfahrenExterner LinkKristin Valla, geboren 1975, hatte Anfang der 2000er Jahre mit ihren ersten Romanen, u.a. „Muskat“, Erfolg, auch international. Bis dahin hatte sie Journalismus studiert, sowie Spanisch und Französisch und Lateinamerikanische Studien und dafür ein Jahr in Venezuela verbracht. Dann heiratete sie, bekam zwei Söhne und nahm eine feste Stelle als Journalistin an. Ihr literarisch-kreativer Impuls verkümmerte darüber. Deshalb entschließt sie sich im Alter von 40 Jahren – und davon berichtet sie in ihrem Buch – ein Haus in Südfrankreich zu kaufen. Dort erhofft sie sich, abseits von der Familie, wieder zum Schreiben zurückzufinden. Doch in den ersten Jahren muss sie das Haus umfangreich renovieren, was ihre gesamte Zeit, die sie dort verbringt, verlangt. Ausführlich schildert Valla die Mühsal dieser Arbeiten, ihre regelmäßigen Weinkrämpfe und die Rückschläge, die sie immer wieder ereilen. Dennoch erlebt sie diese Arbeit als sehr selbstbestimmt – zum ersten Mal seit vielen Jahren. Sie fragt sich, was ihre Bedürfnisse sind und wie sie ihr Haus entsprechend einrichten will. Dadurch bahnt sie sich tatsächlich einen Weg zum Schreiben zurück, das sie zunächst – paradoxerweise – zuhause in Oslo, im Kreis ihrer Familie, wieder aufnimmt.
Unterbrochen ist der Bericht immer wieder durch die Erfahrungen anderer schreibender Frauen, die sich ein Haus gekauft und einen Raum zum Schreiben geschaffen haben. Virginia Woolf ist darunter nur die bekannteste. Aber Valla erzählt auch von Selma Lagerlöf, Halldis Moren Vessas, Marguerite Duras oder Patrica Highsmith u.v.a. Auf der Grundlage von Tagebüchern, Briefen und Autobiographien schildert sie, wie wichtig für diese schreibenden Frauen, unabhängig von ihren sonstigen partnerschaftlichen und familiären Verpflichtungen, Einsamkeit und Abgeschiedenheit waren, um ihrem Schreiben nachgehen zu können. So zeigen sich an vielen Beispielen und in vielerlei Gestalt die Grundbedingungen für den literarischen Schaffensprozess - nicht nur für den von Frauen. Kristin Valla endet ihren Bericht mit einer entschiedenen Deutung: Virginia Woolf habe ihre berühmte Forderung nach einem Zimmer für sich allein und einem Grundeinkommen nicht symbolisch gemeint, sondern ganz konkret und materiell.
Peter Braun
-
"Juli, August, September" von Olga Grjasnowa
Mehr erfahrenExterner LinkWelche Bedeutung hat die familiengeschichtliche Aufarbeitung der eigenen Identität in einer modernen, globalisierten Welt? Das ist eine der zentralen Fragen des Romans "Juli, August, September" von Olga Grjasnowa, Autorin und Professorin an der Universität für angewandte Kunst in Wien.
Ihr fünfter Roman handelt davon, wie die Protagonistin Lou sich scheinbar plötzlich mit ihrer russisch-jüdischen Herkunft und Familiengeschichte auseinandersetzt. Auslöser ist ein Erlebnis ihrer 5-jährigen Tochter Rosa, die der Überzeugung ist, bei ihrer Freundin ein Buch von Adolf Hitler gelesen zu haben. Lou nimmt sich daher vor, ihrer Tochter ihre jüdischen Wurzeln näher zu bringen, wofür ihr Mann, der bekannte und erfolgreiche Pianist Sergej, wenig Enthusiasmus aufbringt. Und so beginnt Lous vermeintliche Odyssee von Berlin über Gran Canaria nach Israel. Dabei verhandelt sie immer wieder ihre eigene Zugehörigkeit und erkundet die Wahrheit ihrer Familiengeschichte.
Es scheint, dass sich in dem Roman nur marginale Geschehnisse ereignen. Es erfolgt ein lose verknüpfter Ablauf von Auseinandersetzungen mit schwerwiegenden Themen, die sich durch eine auffällige Simplizität und Alltäglichkeit auszeichnen. Zu den Themen zählen unter anderem der Nationalsozialismus sowie die Frage, welche Personen auf welche Art und Weise innerhalb der Familie darüber sprechen dürfen. Darüber hinaus drängen sich eine Ehekrise und eine Diskussion über die Vereinbarkeit von Familie und Erfolg auf.
Die Charaktere manifestieren sich insbesondere in den von ihnen geführten eindrücklichen Dialogen. Dadurch werden nicht nur die eigenen Überzeugungen auf glaubhafte Weise deutlich, sondern auch die Dickköpfigkeit der jeweiligen Figur. Es ist festzustellen, dass alle Mitglieder der Familie in ihren jeweiligen Ansichten so sehr verhaftet sind, dass es für Lou kaum möglich ist, einen Platz unter ihnen zu finden.
"Juli, August, September" ist eine auf den ersten Blick oberflächliche Alltagsgeschichte über Familiendramen, welche jedoch mit stellenweise historischen Tiefenschichten auf der Suche nach der eigenen Identität und Zugehörigkeit ergänzt wird. Wer allerdings Antworten auf Identitätsfragen erwartet, ist mit diesem Buch falsch beraten. Vielmehr handelt es sich um eine Bestandsaufnahme im Spannungsfeld junger Familien im hippen, modernen Berlin und der Aufarbeitung jüdischer Migrationsgeschichte.
Insgesamt wirkt der Roman jedoch teilweise zusammengewürfelt und dem Zufall überlassen. So beschreibt Grjasnowa auf einer Lesung in Weimar am 10. April 2025: “Der Ort Gran Canaria hat keine besondere Bedeutung. Ich finde Gran Canaria einfach lustig, und deshalb wollte ich es in den Roman einbauen. Das ist manchmal das Problem, wenn ich etwas lustig finde, aber sonst niemand”. Weiterführend erläutert sie, dass der Roman auf einem Essay basiert, mit dem sie zunächst äußerst unzufrieden war. Juli, August, September entstand daher eher aus dem Zwang, den Essay in eine narrative Geschichte zu verwandeln.
Schlussendlich erzählt der Roman eine interessante Geschichte und hinterlässt die Leserschaft mit einigen Fragen und keinen Antworten.
Corinna Schüller
-
„Der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr“ von Elvis Peeters
Mehr erfahrenExterner LinkVier jugendliche Mädchen heben auf einer Autobahnbrücke ihre Röcke. Ihr Ziel: Herausfinden, wie viel Macht ihre Nacktheit hat und zu sehen, wie leicht die Erwachsenen abzulenken sind. Dann geschieht ein schrecklicher Unfall, gefilmt von den vier Jungs, die sich im Gebüsch verstecken. So beginnt der endlose Sommer des Romans „Der Sommer, als wir unsere Röcke hoben und die Welt gegen die Wand fuhr“ von Elvis Peeters. Dieser entstand in Zusammenarbeit mit seiner Frau Nicole Van Bael und löste in Belgien und den Niederlanden einen Skandal aus.
Doch von vorne: Elvis Peeters lässt uns in dem Buch einen Sommer mit acht Freund*innen verbringen. Die vier Mädchen und vier Jungen kommen aus guten Verhältnissen, haben keine Sorgen, sind unerfahren und unverantwortlich. Was sie antreibt, ist das Ausloten ihrer Grenzen und das Überschreiten derselben. Der Roman begleitet die Figuren beim Erwachsenwerden, doch an keiner Stelle lässt sich eine moralische Entwicklung feststellen. Stattdessen steigern sich die Geschehnisse im Verlaufe der Handlung immer weiter ins Groteske. Die Jugendlichen fühlen sich unbesiegbar und sehen in ihren Handlungen keine Probleme. Stattdessen rechtfertigen sie sich immer wieder damit, dass sie jung sind.
Auch in der harten, direkten und vulgären Sprache, in der Peeters schreibt, kommt diese Atmosphäre klar hervor. So werden Leser*innen mit Sätzen wie “Vier junge Mösen. Wer wollte das nicht sehen?” (S. 13) und “Ein Schwanz ist ein Schwanz, egal, wem er gehört” (S. 171) konfrontiert. Sie vermittelt das Gefühl der absoluten Freiheit und Unbesiegbarkeit der Jugend, in der sich die Freundesgruppe suhlt. Der Autounfall, von dem man nicht wegschauen kann, scheint eine gute Beschreibung für das Leseerlebnis dieses Buchs zu sein. Als Leser*in empfindet man nicht an wenigen Stellen ein Gefühl der Abscheu. Es scheint beinahe so, als wollte Peeters mit diesem Roman bewusst die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten, ähnlich wie seine Figuren jegliche Grenzen immer weiter verschieben. Kein Wunder also, dass das Buch als so skandalös aufgenommen wird.
Der Roman ist provokativ, überschreitet moralische Grenzen und lässt einen als Leser*in aufgewühlt zurück. Die drastische Darstellung, die teils als übertrieben wahrgenommen werden kann, schafft es dennoch durch eine präzise, bewusst gewählte Sprache eine Energie einzufangen, die einen beim Lesen nicht mehr loslässt. Und ist es nicht schlussendlich die Aufgabe von Literatur (und Kunst generell), Grenzen zu überschreiten und Leser*innen zum Reflektieren ihrer Moral aufzufordern?
Danielle Martens