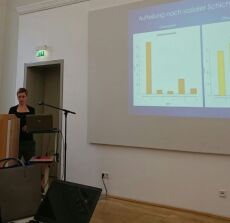PD Dr. Barbara Aehnlich
Barbara Aehnlich
Foto: Anne Günther (Universität Jena)PD Dr. Barbara Aehnlich
Friedrich-Schiller-Universtität Jena
Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Zimmer 205
Fürstengraben 30
07743 Jena
E-Mail: barbara.aehnlich@uni-jena.de
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung
http://projekte.thulb.uni-jena.de/flurnamen/html#thulb-ps-headerExterner Link
dhnet.uni-jena.deExterner Link
Beitrag "Frauen im Fokus"
-
Projekte
Forschungsschwerpunkte
Onomastik
Frühneuhochdeutsch
Historische Rechtssprache
Digital Humanities
Korpuslinguistik
Genderlinguistik
Forschungsprojekte
Verteütſcht das yeder die mag leſen? Die sprachliche Vermittlung neuer Rechtsinhalte im Zuge der Rezeption des römischen Rechts für Rechtspraktiker. Dargestellt am Beispiel des Klagspiegels Conrad Heydens und des Laienspiegels Ulrich Tenglers.
Mein Habilitationsprojekt ist interdisziplinär an der Schnittstelle zwischen diachroner Korpuslinguistik und Rechtsgeschichte angesiedelt. Dabei untersuchte ich zwei Rechtsbücher des 15. und 16. Jahrhunderts (den Klagspiegel Conrad Heydens und den Laienspiegel Ulrich Tenglers) hinsichtlich ihrer sprachlichen Besonderheiten und ihrer Auswirkungen auf die Rezeptionsgeschichte des römischen Rechts in Deutschland. Beide Texte gehören der sogenannten Praktikerliteratur an, einer Textsorte, die durch die problematische Situation der Rechtspflege im 15. und 16. Jahrhundert notwendig wurde. Es handelt sich dabei um Texte für Laienjuristen, die das römisch-kanonische Recht anwenden mussten, ohne die lateinischen Rechtsquellen verstehen zu können. Um herauszufinden, wie die Verständlichkeit der populärjuristischen Rechtstexte erreicht wurde, untersuchte ich u.a. graphematische und druckerspezifische Besonderheiten, sprachliche Ausgleichsprozesse im Interesse einer möglichst weiträumigen Verständlichkeit, Transfermethoden, wie römisch-rechtliche Inhalte und Fachtermini ins Deutsche übertragen wurden, sowie textsortenspezifische Besonderheiten. Ein diachroner Vergleich einzelner Textfassungen vom Erstdruck bis zur letzten Auflage gibt Aufschluss über die Textgeschichte. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf Phänomene des Sprachwandels in der Entwicklung der Texte gelegt.
Die Lehrbefugnis im Habilitationsverfahren wurde am 25. Juni 2019 erteilt.
Digitaler diachroner Textvergleich zu Rechtstexten der Frühen Neuzeit
Das Projekt stellt frühneuhochdeutsche Rechtsquellen in den Fokus der Forschung (Klagspiegel, Laienspiegel, die Constitutio Criminalis Carolina und die Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung). Forschungsziel ist eine linguistische Untersuchung der Entwicklung und Überformung der frühneuhochdeutschen Rechtssprache in Bezug auf graphematische Charakteristika und Lexik im diachronen Vergleich ausgewählter Textzeugen, wodurch eine „Versionsgeschichte“ der Rechtsquellen sichtbar werden soll. Die frühneuzeitliche Fachsprache des Rechts wird in ihrem Verlauf analysiert und in ihrem Verhältnis zu allgemeinsprachlichen Phänomenen des Frühneuhochdeutschen betrachtet. Die Analyse der Rechtssprache erfolgt dabei mit den Methoden der Digital Humanities: Aus den Textzeugen werden Ausschnitte transkribiert, die zu einem tiefenannotierten Textkorpus zusammengefasst werden. Die linguistische Annotation umfasst die vollständige Lemmatisierung, das PoS-Tagging und die morphologische Analyse sämtlicher Wortformen. Aufgrund der Annotationen wird ein digitaler Textvergleich ebenfalls mit LAKomp vorgenommen, durch den die Entwicklung der Texte im diachronen Verlauf ermittelt wird. Das Projekt wurde von der FSU Jena mit 39.997€ gefördert.
Erste Ergebnisse des Projektes wurden im August auf dem Fachtag „DH in Thüringen“ sowie im September auf der GGSG-Tagung „Historische Korpuslinguistik“ vorgestellt. Auf zwei Tagungen im September wurden Beiträge zu diesem Projekt angenommen; hier werden die Ergebnisse des Projektes vorgestellt und später publiziert.
Erstellung eines frühneuhochdeutschen Rechtskorpus – linguistische Annotationen und Analysen
Im Projekt wurde ein linguistisch und semantisch annotiertes Probekorpus frühneuhochdeutscher Rechtstexte erstellt sowie an wichtigen Rechtstexten der Rezeptionszeit methodische Vorarbeiten und exemplarische linguistische Analysen vorgenommen. Die Quellen sind durch eine hohe dialektale Diversität gekennzeichnet, was eine automatische Sprachverarbeitung zu einer komplexen Herausforderung macht. In Folge des Projektes wird ein Förderantrag eingereicht. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Drittmittelfähigkeit von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der FSU Jena mit 10.000€ gefördert.
Digitalisierung Thüringisches Wörterbuch
Die Erstellung des Thüringischen Wörterbuchs wurde von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften gefördert, das Vorhaben ist seit 2006 abgeschlossen. Das seit 1907 gesammelte zugehörige Material mit etwa 5,5 Millionen Wortbelegen liegt derzeit nur in analoger Form vor. Dazu gehören die Belegzettel aus Fragebogenerhebungen, Exzerptionen aus Orts- und Gebietswörterbüchern, Material aus Felduntersuchungen für Qualifikationsarbeiten, aus der thüringischen Mundartdichtung und aus historischen Quellen und Tonbandaufzeichnungen. Dieses Material ist derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Da besonders die Tonbandaufzeichnungen für weitere Forschungen (beispielsweise im Bereich der Syntax) aufschlussreich sein können, fand zwischen April und Juli 2018 eine Digitalisierung der 302 vorhandenen Aufnahmen aus den Jahren 1963-1964 statt, die auf Tonbandkopien vorliegen. Gemeinsam mit dem Multimediazentrum der FSU (Tino Tschiesche, Heiko Röben) wurden die 99 Bänder digitalisiert und können so der wissenschaftlichen Community für zahlreiche dialektologische Fragestellungen zur Verfügung gestellt werden.
Flurnamen und Regionalgeschichte
Das Citizen-Science-Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“ ist angesiedelt beim Heimatbund Thüringen und wurde 1999 begründet. Durch Regionaltagungen und andere Aktivitäten wurden bereits über 300 interessierte HeimatforscherInnen motiviert, die Flurnamen ihrer Heimat zu sammeln und sie nach vorgegebenen Kriterien zusammenzustellen. Im Jahr 2005 habe ich die fachkundliche Betreuung des Projektes übernommen. Ziel des Projektes ist eine flächendeckende Erfassung der Flurnamen in Thüringen. Dies wäre zugleich die Grundlage für eine wissenschaftliche Bearbeitung des gesammelten Materials an der FSU Jena. Die wesentliche Besonderheit und Einmaligkeit des Projektes in Deutschland liegt in der engen Zusammenarbeit von ehrenamtlichen SammlerInnen und Wissenschaft.
Digitalisierung und Aufbereitung des Thüringischen Flurnamenarchivs
Das Thüringische Flurnamenarchiv umfasst ca. 150.000 Flurnamenbelege in Zettelkastenform. Dadurch ist es weder für die universitäre Forschung noch für die interessierte Öffentlichkeit nutzbar. Um diesem Missstand abzuhelfen, wurde bereits eine Datenbank entwickelt, in welche ca. 30.000 Belege durch manuelle Transkription aufgenommen wurden. Mithilfe der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek und Unterstützung des Thüringer Landesamts für Vermessung und Geoinformation soll nun eine Digitalisierung des Archivs erfolgen, die die vorhandenen Belege mit Geodaten verknüpft und das Material in Collection@UrMEL zur Verfügung stellt. Hinzu kommen Belege aus Abschlussarbeiten, die an der Professur für Geschichte der deutschen Sprache betreut wurden, aus dem von mir wissenschaftlich begleiteten Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“ (vgl. oben) sowie aus von mir durchgeführten Projektseminaren. Alle Daten sollen georeferenziert in einer Datenbank zusammengefügt und über ein Thüringer Flurnamenportal für Forschung und Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden. Das Projekt wird von der Thüringer Staatskanzlei gefördert.
Portal: http://projekte.thulb.uni-jena.de/flurnamen/projekt.html
Vergleichende deutsch-georgische Vornamenstudie
In einer 2016 durchgeführten kontrastiven Analyse der Namenmoden im deutsch-georgischen Vergleich wurde zeitgleich in Deutschland und Georgien eine Pilotstudie durchgeführt, in welcher die Benennungsmotive bei der Namenwahl analysiert wurden. Mittels Online- und Papierfragebögen wurden insgesamt 1.013 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer befragt, 617 Personen auf deutscher und 395 Personen auf georgischer Seite. Es wurden gesellschafts- und geschlechterspezifische Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Vergabe der Vornamen ebenso untersucht wie eine schichtenspezifische oder regionale Verteilung. Bedeutsame Unterschiede gab es bei den Benennungsmotiven Tradition und Verwandtschaft, Religion und Mode sowie Klang. Die Ergebnisse wurden im Herbst 2016 vorgestellt und werden voraussichtlich im Sommer 2020 publiziert.
Projekte in der Lehre
Mind the Gap – Karriere statt Barriere!
Die Wanderausstellung „Mind the Gap – Karriere statt Barriere!“ wurde im Rahmen eines Projektseminars an der FSU Jena im Wintersemester 2016/17 unter der Leitung von Dr. Andreas Christoph, Dr. André Karliczek, Dr. Michael Markert und mir gemeinsam mit Studierenden der FSU sowie der BU Weimar konzipiert und erarbeitet. Im Fokus der Ausstellung stehen die einzelnen Karriereschritte vom Studium bis zur Berufung, wobei vor allem geschlechterspezifische Barrieren im Wissenschaftssystem thematisiert werden. Die Ausstellung besteht aus Rollups für die einzelnen Karriereschritte und wird ergänzt um eine Webseite sowie ein Begleitheft. Während die Informationen auf den Tafeln nur sehr knapp und teilweise pointiert zugespitzt dargestellt werden, enthalten das Beiheft und die Homepage tiefergehende Informationen, Statistiken und Grafiken und stellen ausgewählte Maßnahmen der Thüringer Hochschulen vor, mit denen diese der „Leaky Pipeline“ begegnen. Die Ausstellung ist im Wechsel an den Thüringer Hochschulen zu sehen – zuletzt am 8. März 2018 an der FSU Jena bei der „Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“. Die Ausstellung wurde vom Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung mit 3.000€ gefördert.
Projektseminare zur Dokumentation und Analyse von Flurnamen
In den Jahren 2008, 2009, 2010 und 2014 bot ich Projektseminare zur Erfassung und Auswertung von Flurnamen an. In den ersten drei Jahren wurden verschiedene Regionen im Saale-Holzland-Kreis auf ihre Flurnamenlandschaft hin untersucht und die Studierenden lernten alle für eine solche Untersuchung notwendigen Arbeitsschritte kennen – sie erhoben die Namen und deren historische Belege in Archiven und Katasterämtern, führten bei den Einwohnern der Orte Befragungen durch, um die mundartlichen Lautungen der Namen und ihre heutige Kenntnis aufzuzeichnen, begaben sich auf die Realprobe, um die Geländegegebenheiten zu erfassen, und analysierten auf der Basis all dieser Daten die Namen linguistisch. Nach Abschluss der Arbeiten wurden die studentischen Forschungen in den untersuchten Gemeinden der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Im Rahmen der Projekte von 2008-2009 entstand zudem eine Publikation zu den „Flurnamen im Reinstädter Grund“ (2010), die von der Sparkassenstiftung mit 1.000 € gefördert wurde.
Im Seminar von 2014 erfassten die Studierenden Stätten früheren Flachsanbaus und ehemaliger Flachsverarbeitung anhand darauf hinweisender Flurnamen, die sich bis heute in Karten, Urkunden und Katastern finden. Diese kulturgeschichtlich motivierten Onyme wurden analysiert und kartografisch aufbereitet. Der Fokus lag auf dem Gebiet des Freistaates Thüringen. Im Projektseminar erfolgte eine Zusammenarbeit mit der codematix GmbH, wo ein Kurs zum Thema „GIS-Spezialanwendungen“ Übersichtskarten zur früheren Verbreitung des Flachsanbaus und der Flachsbearbeitung auf der Basis der Daten erarbeitete, die die Studierenden erhoben und zusammenstellten. Die Ergebnisse dieses Seminars flossen in meinen Aufsatz „Flachsanbau und -verarbeitung im Spiegel thüringischer Flurnamen. Untersuchungen im Rahmen eines Projektseminars“ im Sammelband „Namen und Kulturlandschaften“ (2015) ein.
-
CV
Vita
- 2004: Studienabschluss M.A. an der Friedrich-Schiller-Universität Jena in den Fächern:
Germanistik, Psychologie und Rechtwissenschaften (Note: 1,1) - 2004 - 2005: Stipendium aus Mitteln der Frauenförderung der FSU Jena
- Seit 2005: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FSU Jena, Institut für Germanistische Sprachwissenschaft, Lehrstuhl für Sprachgeschichte
- 2011: Promotion zum Dr. phil. mit "summa cum laude"
(Dissertation zum Thema: Die thüringische Flurnamenlandschaft - Wege zu ihrer Erforschung) - Seit 2012: Arbeit am Projekt "Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Klagspiegel Conrad Heydens (1436) und zum Laienspiegel Ulrich Tenglers (1509)"
- seit Oktober 2015: Koordinatorin des DHnet Jena (dhnet.uni-jena.deExterner Link)
- Juni 2016 - September 2017: wissenschaftliche Mitarbeiterin im Thüringer Kompetenzzentrum Gleichstellung (TKG) (http://www.tkg-info.de/)Externer Link
- Oktober 2017 - September 2018: Externe Lektorin an der AAU Klagenfurt
- 2019: Habilitation und Erteilung der Lehrbefugnis
- Wintersemester 2019/20 und Sommersemester 2020: Vertretung der Professur für Geschichte der deutschen Sprache (FSU Jena)
- Oktober 2020 - März 2021: Externe Lektorin an der AAU Klagenfurt
- Wintersemester 2020/21: Vertretung der Professur für eHumanities (MLU Halle-Wittenberg)
- April 2021 - April 2022: Mitarbeiterin im Projekt Data Literacy (https://www.dataliteracy.uni-jena.de/)
- seit Januar 2022: Projektleiterin "Flurnamen als Brücke zwischen Gesellschaft und Wissenschaft"
- seit Mai 2022: Lektorin an der Universität Bremen
- 2004: Studienabschluss M.A. an der Friedrich-Schiller-Universität Jena in den Fächern:
-
Publikationen
Publikationsverzeichnis
Monographien und Herausgeberschaften
- Aehnlich, Barbara (2020): Rechtspraktikerliteratur und neuhochdeutsche Schriftsprache. Conrad Heydens Klagspiegel und Ulrich Tenglers Laienspiegel. Berlin: Peter Lang.
- Mind the Gap. Karriere statt Barriere! Broschüre zur Ausstellung. Herausgegeben von Barbara Aehnlich, Andreas Christoph, André Karliczek und Michael Markert, Jena 2017: uni-jena.de/mind_the_gap.
- Namen und Kulturlandschaften. Herausgegeben von Barbara Aehnlich und Eckhard Meineke, Leipzig 2015.
- Flurnamen Thüringens. Der westliche Saale-Holzland-Kreis, baar, Hamburg 2012.
- Die thüringische Flurnamenlandschaft – Wege zu ihrer Erforschung, Dissertation Jena 2011, Digitale Bibliothek Thüringen: http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=20027.
- Die Flurnamen des Reinstädter Grundes, hrsg. von Barbara Aehnlich und Susanne Wiegand (= Thüringer Hefte für Volkskunde, Band 17), Erfurt/Jena 2010.
- Handreichung für Flurnamensammler. Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte – Aufgaben und Möglichkeiten bei der Sammlung, Archivierung und namenkundlich-siedlungsgeschichtlichen Erforschung der Flurnamen der Thüringer Gemeinden“, herausgegeben vom Heimatbund Thüringen e.V., Weimar 2008.
- Sprachgeschichtliche Untersuchungen zu den Flurnamen der Gemarkung Ammerbach bei Jena, VDM-Verlag, Saarbrücken 2008.
Aufsätze und Beiträge zu Handbüchern und Sammelbänden (in Auswahl)
- Das Thüringer Flurnamenportal – Ein Werkstattbericht, in: Namenkundliche Informationen (NI) 113 (2021), hrsg. von Michael Prinz und Inga Siegfried-Schupp, S. 35-52.
- Kulturelle Spezifik der deutschen und georgischen Vornamen (gemeinsam mit Manana Bakradze, Miranda Gobiani, Diana Schluchtmann und Jakob Wünsch), in: Hengst, Karlheinz (Hg.): Namenforschung und Namenberatung (Onomastica Lipsiensia 14), Leipzig 2021, S. 47-69.
- Fachtermini und Regionalismen – Perspektiven auf die populärjuristische Fachsprache der Frühen Neuzeit (gemeinsam mit Elisabeth Witzenhausen), in: Klein, Wolf Peter; Staffeldt, Sven: Zur Geschichte der Fach- und Wissenschaftssprachen: Identität, Differenz, Transfer (WespA. Würzburger elektronische sprachwissenschaftliche Arbeiten 23), Würzburg 2021, S. 5-24 (urn:nbn:de:bvb:20-opus-251173)
- Standardisierung in frühneuhochdeutschen Rechtsquellen, in: Rössler, Paul; Besl, Peter; Saller, Anna (Hgg.): Historische Schrift- und Schriftlichkeitsforschung (Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte 12), Berlin/Boston: de Gruyter 2021, S. 229-250. (https://www.degruyter.com/journal/key/jbgsg/html)
- Teaching Digital Heritage and Digital Humanities. A current state and prospects (mit Sander Münster, Katrin Fritsche, Volker Schwartze, Fabrizio Apollonio, Fulvio Rinaudo, Rosa Tamborrino, Heather Richards-Risetto), in: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLVI-M-1-2021 28th CIPA Symposium “Great Learning & Digital Emotion”, 28 August–1 September 2021, Beijing, China. (https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVI-M-1-2021-471-2021)
- Malefiz, Missetat und Sünde – Zum Wortfeld des Begriffs von Verbrechen und Straftaten im Laienspiegel Ulrich Tenglers (1511) (gemeinsam mit Henry Seidel), in: Bär, Jochen (Hg.): Historische Text- und Diskurssemantik (Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte 11), Berlin/Boston 2020, S. 147-160. (DOI: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbgsg-2020-0011/html)
- Graphematische Untersuchung zu Drucken des Klag- und Laienspiegels (gemeinsam mit Elisabeth Witzenhausen), in: Ihden, Sarah; Dreesen, Katharina; Langhanke, Robert: Studien zur mittelniederdeutschen und frühneuhochdeutschen Sprache und Literatur. Hildesheim, Zürich, New York: Olms (Kleine und regionale Sprachen), S. 209-235.
- Aehnlich, Barbara (2021): Was du nit waißt das ſolt du fragen / laſs dir das ain̄ geleerten ſagen / Oder der mer recht hab erfarn – Wissenstransfer in der populären juristischen Literatur der Frühen Neuzeit, in: Zwischen Himmel und Alltag. Wissen und Gemeinschaft vom Hochmittelalter bis in die Frühe Neuzeit, Tagungsband der Klagenfurter Tagung 2018, Peter Lang Verlag (Reihe „Medieval to Early Modern Culture / Kultureller Wandel vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit“), Klagenfurt (erscheint im Herbst 2022).
- Macht Gendern die Sprache gerechter? In: Goethe-Tage 2019, herausgegeben von der Ortsvereinigung der Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V., Kutaissi 2019, S. 7-21.
- Die thüringische Flurnamenforschung wird digital, in: Heimat Thüringen, 26. Jahrgang, Heft 4, 2019, S. 21-24. (https://www.heimatbund-thueringen.de/publikationen/zeitschrift-heimat-thueringen/heimat-thueringen-heft-42019/)
- Von Käsenapf und Ritterspiel – Einführung in die Flurnamenlandschaft des Saale-Holzland-Kreises, in: Burg und Herrschaft sowie Jena und der Saale-Holzland-Kreis im frühen und hohen Mittelalter, Beiträge zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens 8, herausgegeben von Pierre Fütterer, Andreas Hummel, Peter Sachenbacher, Hans-Jürgen Beier, Langenweißbach 2018, S. 11-18.
- Ortsnamen des Eichsfeldes und ihre Bildung, in: Das Eichsfeld (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 79), herausgegeben von Ulrich Harteisen, Ansgar Hoppe, Hansjörg Küster, Torsten W. Müller, Haik Thomas Porada, Gerold Wucherpfennig im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, Wien 2018 (inklusive 1 Karte), S. 163-166.
- Die Mundart des Eichsfeldes, in: Das Eichsfeld (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 79), herausgegeben von Ulrich Harteisen, Ansgar Hoppe, Hansjörg Küster, Torsten W. Müller, Haik Thomas Porada, Gerold Wucherpfennig im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, Wien 2018 (inklusive 1 Karte), S. 166-170.
- Ortsnamen des Eichsfeldes – Namendeutung in den Suchpunkten, in: Das Eichsfeld (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 79), herausgegeben von Ulrich Harteisen, Ansgar Hoppe, Hansjörg Küster, Torsten W. Müller, Haik Thomas Porada, Gerold Wucherpfennig im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, Wien 2018.
- Die Ortsnamen des Hainich, in: Der Hainich (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 77), herausgegeben von Manfred Großmann, Uwe John und Haik Thomas Porada im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, 2018, 119-122 (inklusive 1 Karte).
- Die Ortsnamen des Hainich – Namendeutung in den Suchpunkten, in: Der Hainich (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 77), herausgegeben von Manfred Großmann, Uwe John und Haik Thomas Porada im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, 2018.
- … vnd das gemeyn recht in treflicher handelung offenbar werde in Teütſchem geſatzt … – Zur Entwicklung der deutschen Rechtssprache seit der Rezeption des römischen Rechts, in: Goethe-Tage 2017, herausgegeben von der Ortsvereinigung der Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V., Kutaissi 2017, S. 23-33.
- Die Mundarten des Orlatals, in: Das Orlatal und das Plothener Teichgebiet (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 76), herausgegeben von Martin Heinze, Haik Thomas Porada und Marek Wejwoda im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, Wien 2017, S. 127-129 (inklusive 1 Karte).
- Die Ortsnamen des Orlatals (gemeinsam mit Christian Zschieschang), in: Das Orlatal und das Plothener Teichgebiet (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 76), herausgegeben von Martin Heinze, Haik Thomas Porada und Marek Wejwoda im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, Wien 2017, S. 121-127 (inklusive 1 Karte).
- Die Ortsnamen des Orlatals – Namendeutung in den Suchpunkten (gemeinsam mit Christian Zschieschang), in: Das Orlatal und das Plothener Teichgebiet (= Landschaften in Deutschland. Werte der deutschen Heimat, Band 76), herausgegeben von Martin Heinze, Haik Thomas Porada und Marek Wejwoda im Auftrag des Leibniz-Instituts für Länderkunde und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Köln, Weimar, Wien 2017.
- Sozio- und pragmaonomastische Implikationen der Benennungspraxis am Beispiel der Christiana von Goethe (gemeinsam mit Anja Stehfest), in: Namenkundliche Informationen 107/108 (2016), herausgegeben von Susanne Baudisch et al., Leipzig, S. 369-396.
- Flachsanbau und -verarbeitung im Spiegel thüringischer Flurnamen. Untersuchungen im Rahmen eines Projektseminars, in: Namen und Kulturlandschaften. Jenaer Symposion. Herausgegeben von Barbara Aehnlich und Eckhard Meineke, Leipzig 2015, S. 5-28.
- Der Flurname Kuhtanz in der Flur Rodameuschel östlich der Saale (gemeinsam mit Karlheinz Hengst), in: Namen und Kulturlandschaften. Herausgegeben von Barbara Aehnlich und Eckhard Meineke, Leipzig 2015, S. 29-38.
- Minka und Findus oder Helga und Brigitte – Individualbenennungen von Haustieren durch Kinder und Jugendliche (gemeinsam mit Elisabeth Witzenhausen), in: Beiträge zur Namenforschung, Band 50, Heft 1/2, 2015, S. 191-218.
- Die Flurnamen des Raumes Dornburg – Zeugnisse der Heimatgeschichte, in: Dornburg. Geschichte und Geschichte, Band 2, herausgegeben von der Chronikgruppe im Dornburger Impressionen e.V., Jena 2014, S. 80-97.
- Flurnamen – sprachliche Zeugnisse von Religiosität in der Landschaft, in: Religion und Landschaft, Bund Heimat und Umwelt (BHU), 2013, S. 64-71.
- Flurnamen als Zeugnisse der Regionalgeschichte, in: Zwischen Saale und Ilm. Vom Leben auf der Saale-Ilm-Platte im Wandel der Zeiten von einst bis jetzt, Broschüre No. 5, hrsg. vom „Stiewartser Traditionsverein“ e.V., Stiebritz 2011, S. 41-52.
- Das Thüringer Flurnamen-Projekt, in: Mikrotoponyme. Jenaer Symposion 1. und 2. Oktober 2009. Herausgegeben von Eckhard Meineke und Heinrich Tiefenbach, Heidelberg, 2011, S. 13-37.
- Symposion des Arbeitskreises für Namenforschung (gemeinsam mit Christian Zschieschang/Leipzig), in: Namenkundliche Informationen 95/96 (2009), herausgegeben von Karlheinz Hengst, Ernst Eichler und Dietlind Krüger, Leipzig, S. 374-382.
Beiträge zu Wörterbüchern
- Rechtsterminus (Einzelartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 03. Historische Sprachwissenschaft. Hg. von Mechthild Habermann und Ilse Wischer, Berlin/Boston, im Erscheinen.
- Rechtstext (Einzelartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 03. Historische Sprachwissenschaft. Hg. von Mechthild Habermann und Ilse Wischer, Berlin/Boston, im Erscheinen.
- Rechtsformel (Einzelartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 03. Historische Sprachwissenschaft. Hg. von Mechthild Habermann und Ilse Wischer, Berlin/Boston, im Erscheinen.
- Rechtsbuch (Einzelartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 03. Historische Sprachwissenschaft. Hg. von Mechthild Habermann und Ilse Wischer, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/database/WSK/entry/wsk_id_wsk_artikel_artikel_28551/html.
- Thüringisch (Einzelartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 03. Historische Sprachwissenschaft. Hg. von Mechthild Habermann und Ilse Wischer, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/database/WSK/entry/wsk_ida6c1d578-06df-45bb-8f29-72e5f39d6b69/html.
- Flurname (Synposeartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19. Onomastik. Hg. von Kirstin Casemir und Eckhard Meineke, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/document/database/WSK/entry/wsk_idc4d0e33f-e357-4f7c-b055-a25d83268ea3/html.
- Mikrotoponym (Synopseartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19. Onomastik. Hg. von Kirstin Casemir und Eckhard Meineke, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/document/database/WSK/entry/wsk_id6f2d8fe9-320e-44b1-a298-8bfc411157c7/html.
- Mikrotoponomastik (Einzelartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19. Onomastik. Hg. von Kirstin Casemir und Eckhard Meineke, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/document/database/WSK/entry/wsk_einzelartikel_10978797/html.
- Ereignisname (Kurzartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19. Onomastik. Hg. von Kirstin Casemir und Eckhard Meineke, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/document/database/WSK/entry/wsk_idfbeb86a9-e52b-43b4-9a21-8fd0e10eea93/html.
- Flurnamenarchiv (Kurzartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19. Onomastik. Hg. von Kirstin Casemir und Eckhard Meineke, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/document/database/WSK/entry/wsk_id198e3854-39ee-4085-8d28-da209e2a2080/html.
- Primärer Flurname (Kurzartikel), in: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 19. Onomastik. Hg. von Kirstin Casemir und Eckhard Meineke, Berlin/Boston, https://www.degruyter.com/document/database/WSK/entry/wsk_id6f33ced9-df71-4fda-938e-2420ee54ab0b/html.
Poster
- Mord und Totschlag im linguistischen Vergleich (gemeinsam mit Katharina Brückner, FSU Jena); Fachtag Digital Humanities in Thüringen; Gotha; 09.08.2018.
- DH-Toolvergleich im Hinblick auf Texte historischer Sprachstufen (gemeinsam mit Henry Seidel, HU Berlin); DHd-Tagung Köln 2018; 01.03.2018.
- Das Tool LAKomp und seine Anwendung auf Texte nichtstandardisierter Sprachstufen (gemeinsam mit Sylwia Kösser, Universität Halle-Wittenberg); DHd-Tagung Leipzig 2016; 3. Preis des DHd-Poster-Award Leipzig 2016; 09.03.2016.
- Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Klagspiegel Conrad Heydens (1436) und zum Laienspiegel Ulrich Tenglers (1509); FSU Jena, Tag der Forschung, 06.2105.
- Annotation nicht-standardisierter Sprachstufen. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Klagspiegel Conrad Heydens (1436) und zum Laienspiegel Ulrich Tenglers (1509) – Zu einem Korpus frühneuhochdeutscher Rechtstexte, DHd-Tagung an der Karl-Franzens-Universität Graz vom 23.-28. Februar 2015 (gemeinsam mit Elisabeth Witzenhausen)
Rezensionen
- Daniel Kroiß: Humanistennamen. Entstehung, Struktur und Verbreitung latinisierter und gräzisierter Familiennamen (Lingua Academia, Bd. 6), 2021, erscheint in PBB 144/3.
- Achim Fuchs: Die Ortsnamen des Altkreises Meiningen und ihre Aussagen zum frühmittelalterlichen Siedlungsgeschehen, 2021, erscheint in ZThG 76 (2022).
- Friedel Helga Roolfs: Brinkmann, Brinker, Steinbrink. Familiennamen mit BRINK (Familiennamen in Westfalen 2), in: Beiträge zur Namenforschung, Bd. 46, Heft 4 (2021), S. 407-409.
- Bernd Eigenmann: Nördlingen – Der ehemalige Landkreis. Historisches Ortsnamenbuch von Bayern 15, Regierungsbezirk Schwaben, München: Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 2020, 402 Seiten, in: Beiträge zur Namenforschung, Bd. 56, Heft 3 (2021), S. 292-296.
- Renata Szczepaniak, Stefan Hartmann, Lisa Dücker (Hgg.): Historische Korpuslinguistik, De Gruyter, Berlin/Boston 2019 (= Jahrbuch für germanistische Sprachgeschichte, Band 10), in: Zeitschrift für deutsche Philologie, Bd. 140, Heft 1/2021 (ZfdPh), S. 135-142.
- Lühr, Rosemarie; Faßhauer, Vera; Prutscher, Daniela; Seidel, Henry (Hg.): Genderspezifik in thüringischen Fürstinnenkorrespondenzen der Frühen Neuzeit. Korpusphilologische Studien, Hamburg 2018. URN: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:27-dbt-20190529-1410179.
- Friedel Helga Roolfs (Hg.): Bäuerliche Familiennamen in Westfalen, Münster: Aschendorf 2016, 96 S., in: Rheinische Vierteljahrsblätter (RVJG), Band 82/2018, S. 7-9.
- Kirstin Casemir (Hg.): Namen und Appellative der älteren Sprachschichten, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2015 (Schriften zur vergleichenden Sprachwissenschaft 14), 220 S., in: Zeitschrift für deutsche Philologie (ZfdPh), Band 135. Heft 3/2016, S. 473-478.
Kleinere Aufsätze
- Angsttor, Diebsteg, Kochlöffel – Zu den Flurnamen der Stadt Erfurt, in: Stadt und Geschichte. Zeitschrift für Erfurt, Nr. 78, 02/2021, S. 5-7.
- DH-Toolvergleich im Hinblick auf Texte historischer Sprachstufen (gemeinsam mit Henry Seidel, HU Berlin); in: Kritik der digitalen Vernunft. DHd 2018 Köln. Konferenzabstracts, Köln 2018, S. 373-374.
- Das Tool LAKomp und seine Anwendung auf Texte nichtstandardisierter Sprachstufen (gemeinsam mit Sylwia Kösser), in: DHd 2016. Konferenzabstracts, Leipzig 2016, S. 263-264.
- Vernetzung ist wichtig, Vernetzung ist gut – Aber wie vernetzt man richtig? (gemeinsam mit Patrick Pfeil), in: DHd 2016. Konferenzabstracts, Leipzig 2016, S. 38-39.
- Tagung „Namen und Kulturlandschaften“ am 1. und 2. Oktober 2014 in Jena, in: Flurnamen-Report 4/2014, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte, S. 1.
- Bleiche, Röste, Werg – Namen als Spiegel der Kulturgeschichte, in: Flurnamen-Report 3/2014, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1-2.
- Thüringische Flurnamen mit religiösem Bezug, in: Flurnamen-Report 1-2/2013, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 3-4.
- Literaturhinweis: Hans Rhode: Stiebritz. Beiträge zur Dorfgeschichte. Stiebritz 2012, in: Flurnamen-Report 4/2012, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 6.
- Literaturhinweis: Inge Bily: Potsdam bis München: Die Ausfahrten der A 9 – ihre Namen kurz erklärt. Leipzig 2012, in: Flurnamen-Report 2/2012, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 10.
- Literaturhinweis: Horst Naumann: Flurnamen. Struktur – Funktion – Entwicklung. Hamburg 2011; in: Flurnamen-Report 1/2012, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 6.
- Literaturhinweis: Eckhard Meineke; Heinrich Tiefenbach (Hrsg.): Mikrotoponyme. Jenaer Symposion 1. und 2. Oktober 2009. Heidelberg 2011; in: Flurnamen-Report 1/2012, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 5-6.
- Blutrinne, Schlachtberg, Heulen und Geschrei, in: Flurnamen-Report 1/2012, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1.
- Vom Schingeleich zum Schindergraben, in: Flurnamen-Report 4/2011, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 2-3.
- Anger, Nasstal, Satschen – Die Flurnamen der Gemeinde Rothenstein/Ölknitz, in: 786-2011. 1225 Jahre Geschichte in Rothenstein, Rothenstein, S. 158-164.
- Quelle, Born und Brunnen – Quellenbezeichnungen in thüringischen Flurnamen, in: Flurnamen-Report 3/2010, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 2.
- Noch einmal der Kuhtanz, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 3/2010, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1-2.
- Der Kuhtanz – Ein Flurname nur in Ostthüringen?, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 1/2010, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1-2.
- Flurnamen als Quelle der Ortsgeschichtsforschung – Zum Flurnamenbestand der Gemarkung Langensalza, in: Heimat Thüringen, 16. Jahrgang 2009, Heft 3, S. 16-18.
- Das Thüringer Flurnamenprojekt, in: Heimat Thüringen, 16. Jahrgang 2009, Heft 3, S. 10-13.
- Benennungsmotivation von Flurnamen – Berge und Täler, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 4/2009, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte, S. 2-4.
- Zur Benennungsmotivation von Flurnamen – Bodenbeschaffenheit, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 3/2009, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1-2.
- Arbeitstreffen Digitalisierung in Weimar, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 3/2009, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1.
- Dorf – Feld – Flur: Namenforschung im Kontext, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 2/2009, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1-6.
- Vom Hornissenberg zum Ziegenfraß – Tiere als Erstglied in Flurnamen, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 3-4/2008, Mitteilungen zum Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“, S. 1-3.
- Historische Ackermaße in Flurnamen der Umgebung Arterns, in: Aratora (Zeitschrift des Vereins für Heimatkunde, Geschichte und Schutz von Artern e.V.), Band 18 (2008), S. 130-136.
- Zur Bedeutung der Flurnamensammlung und zum Alter der Flurnamen, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 4/2007, Mitteilungen zum Projekt "Flurnamen und Regionalgeschichte", S. 1-3.
- Die Geschichte der thüringischen Flurnamenforschung, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 2/2007, Mitteilungen zum Projekt "Flurnamen und Regionalgeschichte", S. 1-3.
- Historische Ackermaße in Flurnamen, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 3/2006, Mitteilungen zum Projekt "Flurnamen und Regionalgeschichte", S. 1-4.
- Winter und Sommer – die Jahreszeiten in Flurnamen, in: Heimatbund Thüringen, Flurnamen-Report 2/2006, Mitteilungen zum Projekt "Flurnamen und Regionalgeschichte", S. 1-3.
-
Vorträge
Vorträge
- 13.05.2022: Das kulturelle Gedächtnis einer Region erforschen: Das Thüringer Flurnamenprojekt (gemeinsam mit Tabea Stolte); Forum Citizen Science, Hochschule Sankt Augustin, 12.-13. Mai 2022.
- 21.04.2022: Flurnamen – gebraucht und vergessen?; GfN-Tagung „Namen im Sprachgebrauch“, Universität Innsbruck, 20.-22. April 2022.
- 26.01.2022: Diskursfunktionen der Partikeln NU und NƆ im gesprochensprachlichen Repertoire von SprecherInnen des thüringischen Sprachraums (gemeinsam mit Tabea Stolte und Kathrin Weber); JenLing Kolloquium, online.
- 29.11.2021: Zum Stand des Thüringischen Flurnamenportals; Tagung Flurnamen als Brücke zwischen Gesellschaft und Wissenschaft; FSU Jena, online.
- 05.11.2021: Diskursfunktionen der Partikeln NU und NƆ im gesprochensprachlichen Repertoire von SprecherInnen des thüringischen Sprachraums (gemeinsam mit Tabea Stolte und Kathrin Weber); Saarbrücker Runder Tische für Dialektsyntax (SaRDiS), 4.-6. November 2021.
- 29.10.2021: Von Gänsegurgel und Hauhechel. Zu den Flurnamen im Weimarer Land; Heimat konkret; Museum für Ur- und Frühgeschichte Weimar.
- 17.09.2021: Kulturelle Spezifik der deutschen und georgischen Vornamen (gemeinsam mit Manana Bakradze, Miranda Gobiani, Jakob Wünsch), Internationale Tagung „Soziologische, pragmatische und kulturelle Forschungsperspektiven in Sprache und Sprachwissenschaft“ (= Linguistische Treffen in Wroclaw VIII), 16.-18. September 2021, online.
- 24.08.2021: Vom Zettel zum Datensatz. Die Entwicklung des Thüringer Flurnamenportals (gemeinsam mit Petra Kunze), 27th International Congress of Onomastic Sciences, Kraków, 22.-27. August 2021, online.
- 14.06.2021: Datenkompetenz stärken – Zertifikatsprogramm Data Literacy Jena (DaLiJe) (gemeinsam mit Volker Schwartze), Digital Showcase beim E-Learning-Tag der Universität Jena, FSU Jena.
- 24.09.2020: Standardisierung in frühneuhochdeutschen Rechtsquellen; 12. Jahrestagung der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte e.V. (GGSG): Historische Schrift- und Schriftlichkeitsforschung; 23. bis 25. September 2020, Regensburg/virtuell.
- 10.01.2020: Workshop LAKomp. Lemmatisierung, Annotation, Komparation – Erfassung von Textvarianten (gemeinsam mit Sylwia Kösser); Netzwerktreffen ‚Historische Wissens- und Gebrauchsliteratur‘, 9. bis 11. Januar 2020; Rauischholzhausen.
- 14.11.2019: Vom Archiv zum Portal – die Geschichte der Thüringer Flurnamenforschung und neueste Entwicklungen (gemeinsam mit Petra Kunze und Michael Lörzer); Thüringer Flurnamenkonferenz, FSU Jena.
- 29.10.2019: Gewohnheit und Recht. Die Paarformel in der Rechtspraktikerliteratur der Frühen Neuzeit; öffentlicher Habilitationsvortrag, FSU Jena.
- 27.09.2019: Malefiz, Missetat und Sünde. Zum Wortfeld des Begriffs von Verbrechen und Straftaten im Laienspiegel Ulrich Tenglers (1511) und im Klagspiegel Conrad Heydens (1516) (gemeinsam mit Henry Seidel); 11. Jahrestagung der Gesellschaft für Germanistische Sprachgeschichte (GGSG); 26. bis 28. September 2019, Vechta.
- 23.09.2019: Die Darstellung der Tötungsdelikte und ihrer rechtlichen Folgen in Rechtsquellen der Frühen Neuzeit; HiGeWiS-Tagung „Die Sprache wissenschaftlicher Objekte“, Eichstätt, 22. bis 24. September 2019.
- 12.09.2019: Macht Gendern die Sprache gerechter?; Sommerschule vom 12. bis 17. September, AZU Kutaissi (Georgien).
- 17.07.2019: Die Entwicklung des Thüringer Flurnamenportals (gemeinsam mit Silvio Hermann); Fachtag Digital Humanities in Jena. Portale in Thüringen; FSU Jena
- 18.06.2019: Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder – Ein Beitrag zur Genderlinguistik; wissenschaftlicher Habilitationsvortrag mit Kolloquium, FSU Jena.
- 29.05.2019: Digital Humanities (DH): Neue Perspektiven in der Geisteswissenschaft (gemeinsam mit Robert Gramsch-Stehfest und Christian Knüpfer); Vortragsreihe des Career Service zur Berufsorientierung für Studierende der FSU Jena (Ringvorlesung), FSU Jena
- 21.09.2018: Historische Rechtssprache der Frühen Neuzeit. Eine korpuslinguistische Auswertung zu populärjuristischen Rechtsquellen; 10. Jahrestagung „Historische Korpuslinguistik“ der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte, Bamberg, 20. bis 22. September 2018
- 31.08.2018: Annotations – synchronous and diachronous: data types, cognitive interest, possible deficits, etc. (gemeinsam mit Pia Bergmann und Jeanin Jügler); Workshop Digital Humanities meet Computer Science, FSU Jena
- 21.06.2018: Teütſch red ich mit lateiniſcher zungen – Die Sprache der Rechtspraktiker der Frühen Neuzeit; Universität Rostock
- 08.03.2018: Frauen in Wissenschaft und Forschung – Zur Ausstellung Mind the Gap; FSU Jena
- 01.03.2018: Postervorstellung: DH-Toolvergleich im Hinblick auf Texte historischer Sprachstufen (gemeinsam mit Henry Seidel, HU Berlin); DHd-Tagung Köln 2018
- 23.11.2017: Händisches und halbautomatisches Taggen (gemeinsam mit Henry Seidel, HU Berlin); Thementag DH in Jena; FSU Jena
- 27.10.2017: Frontfrauen. Ein Tag zum Thema Frauen und Karriere; Moderation und Organisation; FSU Jena
- 12.10.2017: Die populärwissenschaftliche Rechtssprache der frühen Neuzeit im Spiegel der Druckersprachen (gemeinsam mit Elisabeth Witzenhausen, Ghent University); HiGeWiS-Tagung "Geschichte der Fach- und Wissenschaftssprachen: Identität, Differenz, Transfer", Würzburg, 12. bis 13. Oktober 2017
- 05.10.2017: Graphematische Untersuchungen zu Drucken des Klag- und Laienspiegels - Zur Bedeutung der Varianten(vielfalt) in frühneuhochdeutschen Druckersprachen (gemeinsam mit Elisabeth Witzenhausen, Ghent University); 8. Kolloquium Forum Sprachvariation der IGD und 6. Nachwuchskolloquium des VndS, Hamburg, 4. bis 6. Oktober 2017
- 10.03.2017: Ausstellungseröffnung: Mind the Gap - Karriere statt Barriere!
- 29.03.2017; Kutaissi: … vnd das gemeyn recht in treflicher handelung offenbar werde in Teütſchem geſatzt … – Zur Historischen Rechtssprache des Deutschen; Akaki-Zereteli-Universität Kutaissi 2017
- 13.10.2016; Jena: Mia und Ben oder Mariami und Luka - Kontrastive Analyse der Namenmoden im deutsch-georgischen Vergleich (gemeinsam mit M. Bakradze, M. Gobiani, D. Schluchtmann, J. Wünsch); Linguistische Tagung: Sprachliche Strukturen im deutsch-georgischen Kontrast, FSU Jena 2016
- 10.03.2016; Leipzig: Panel-Diskussion zum Thema: Vernetzung ist gut, Vernetzung ist wichtig – aber wie vernetzt man richtig? (Chair und Beitrag zum DHnet | Jena); DHd-Tagung Leipzig 2016
- 09.03.2016; Leipzig: Postervorstellung: Das Tool LAKomp und seine Anwendung auf Texte nichtstandardisierter Sprachstufen (gemeinsam mit Sylwia Kösser, Universität Halle-Wittenberg); DHd-Tagung Leipzig 2016; 3. Preis des DHd-Poster-Award Leipzig 2016
- 27.02.2016; Halle/Saale: Flurnamen in der Kulturlandschaft; Weiterbildung für Kulturlandschaftsführer_innen; Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V.
- 05.02.2016; Jena: Das DHnet | Jena – Ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk; Festkolloquium des DHnet | Jena anlässlich seiner Gründung, FSU Jena
- 30.06.2015; Leipzig: Werkzeuge zur Annotation historischer Sprachstufen; 3. Clarin-D Fach-AG Workshop
- 25.06.2105; Jena: Postervorstellung: Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Klagspiegel Conrad Heydens (1436) und zum Laienspiegel Ulrich Tenglers (1509); FSU Jena, Tag der Forschung
- 23.06.2015; Erfurt: Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Klagspiegel Conrad Heydens (1436) und zum Laienspiegel Ulrich Tenglers (1509) – ein Werkstattbericht; DH-Treffen Thüringen an der Universität Erfurt
- 21.03.2015; Magdeburg: Flurnamenforschung – Aufgaben und Möglichkeiten; Fortbildung und Erfahrungsaustausch für Ortschronisten und Heimatforscher; Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V.
- 14.03.2015; Halle/Saale: Flurnamenforschung – Aufgaben und Möglichkeiten; Fortbildung und Erfahrungsaustausch für Ortschronisten und Heimatforscher; Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V.
- 25.02.2015; Graz (Österreich): Postervorstellung: Annotation nicht-standardisierter Sprachstufen. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Klagspiegel Conrad Heydens (1436) und zum Laienspiegel Ulrich Tenglers (1509) – Zu einem Korpus frühneuhochdeutscher Rechtstexte, DHd-Tagung an der Karl-Franzens-Universität Graz vom 23.-28. Februar 2015
- 21.11.2014; Ponitz: Die Flurnamen des Saale-Holzland-Kreises; Archäologie-Tagung „Jena und der Saale-Holzland-Kreis im frühen und hohen Mittelalter“, Tagung im Schloss Ponitz vom 21.-23. November 2014
- 01.10.2014; Jena: Flachsanbau und -verarbeitung in Thüringen. Untersuchungen im Rahmen eines Projektseminars; Symposion „Namen und Kulturlandschaften“ am 1. und 2. Oktober 2014 in Jena; Institut für Germanistische Sprachwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität und Deutsche Gesellschaft für Namenforschung
- 19.03.2014; Jena: Methodik der Sammlung und Dokumentation der thüringischen Flurnamen; Heimatbund Thüringen; Thüringisches Flurnamenarchiv
- 07.03.2014; Golmsdorf: Die Flurnamen von Golmsdorf, Beutnitz und Löberschütz; Heimatbund Thüringen und Verein der Hobbywinzer und Heimatfreunde Golmsdorf; Rathaussaal Golmsdorf
- 26.10.2013; Heilbad Heiligenstadt: Aufgaben, Möglichkeiten und Stand bei der Sammlung und Erklärung der Flurnamen in Thüringen uns speziell im Landkreis Eichsfeld; Heimatbund Thüringen und Verein für Eichsfeldische Heimatkunde; Plenarsaal Neues Rathaus Heiligenstadt
- 07.10.2013; Mainz: „Minka und Findus oder Helga und Brigitte – Individualbenennungen von Haustieren durch Kinder und Jugendliche“; Tagung „Bello, Gin Tonic, Krake Paul – Individualnamen von Tieren“, Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, 7.-8. Oktober 2013
- 15.03.2013; Leinefelde-Worbis, Obereichsfeldhalle Leinefelde: Anger, Gehren, Winterleite – Zur Benennungsmotivation thüringischer Flurnamen; Deutscher Verein für Vermessungswesen, Landesverein Thüringen, Jahresfachtagung 2012
- 15.02.2013; Eisenberg, Gotthard-Pabst-Saal (Bibliothek): Aktueller Stand der vorliegenden und geplanten Abschlussarbeiten an der FSU Jena; Hinweise zur Sammlung und Dokumentation von Flurnamen; Heimatbund Thüringen, Arbeitstreffen für den Saale-Holzland-Kreis
- 05.12.2012; Poxdorf, Alte Schule: Flurnamen und Regionalgeschichte; Heimatbund Thüringen und Gemeinde Poxdorf; Regionaltagung
- 15.09.2012; Kloster Veßra, Hennebergisches Museum, Torkirche: Aufgaben und Möglichkeiten bei der Sammlung und Erklärung der Flurnamen in Thüringen; Heimatbund Thüringen e.V. und Hennebergisch-Fränkischer Geschichtsverein e.V.; Regionaltagung
- 18.02.2012; Jena: Die Flurnamen des westlichen Saale-Holzland-Kreises; Heimatbund Thüringen e.V. / Thüringisches Flurnamenarchiv der FSU Jena
- 21.09.2011; Ellrich, OT Werna: Aufgaben, Möglichkeiten und aktueller Stand bei der Sammlung und Erklärung der Flurnamen in Thüringen; Heimatbund Thüringen e.V.; Regionaltagung für Nordthüringen
- 15.09.2011; Wiehe, OT Donndorf: Geschichte und Stand der Flurnamenforschung und -dokumentation in Thüringen; Heimatbund Thüringen e.V. und Stadt Wiehe; Zur 1225-Jahrfeier der Stadt Wiehe
- 25.05.2011; Saalfeld: Aufgaben, Möglichkeiten und aktueller Stand bei der Sammlung und Erklärung der Flurnamen in Thüringen; Heimatbund Thüringen e.V.; Regionaltagung für Südthüringen
- 19.02.2011; Gera: Aufgaben, Möglichkeiten und aktueller Stand bei der Sammlung und Erklärung der Flurnamen in Thüringen; Heimatbund Thüringen e.V.; Regionaltagung Ostthüringen
- 07.12.2010: Leitung eines Workshops zum Thema Digitale Flurnamenerfassung; Heimatbund Thüringen e.V.
- 25.11.2010: Leitung eines Workshops zum Thema Digitale Flurnamenerfassung; Heimatbund Thüringen e.V.
- 13.10.2010; Leipzig: Die Einbettung von Flurnamen in großlandschaftliche digitale Kataster von Kulturlandschaftselementen – Das Thüringer Flurnamenprojekt; Kolloquium Gesellschaft für Namenkunde
- 18.08.2010; Jena: 100 Jahre thüringische Flurnamenforschung – ein Rückblick; Heimatbund Thüringen e.V.
- 22.06.2010; Pößneck: Die Flurnamenlandschaft an der thüringischen Saale – Wege zu ihrer Erforschung und Dokumentation; Heimatbund Thüringen e.V.
- 16.06.2010; Wasserburg Kapellendorf: Flurnamen und Regionalgeschichte; Veranstaltungen für Ortsgeschichtsbearbeiter, Ortschronisten, Heimatpfleger, Lehrer und interessierte Bürger des Landkreises Weimarer Land
- 24.02.2010; Weimar: Aufgaben und Möglichkeiten bei der Sammlung und Erklärung der Flurnamen in Thüringen; Heimatbund Thüringen e.V.
- 11.02.2010; Rothenstein: Zur Flurnamensammlung in der Gemeinde Rothenstein/Ölknitz – Untersuchungen im Rahmen eines Projektseminars zur Flurnamenforschung
- 24.10.2009: Jena: Zum Stand und den Perspektiven des Thüringer Flurnamenprojektes; Flurnamenkonferenz des Projektes „Flurnamen und Regionalgeschichte“; Heimatbund Thüringen e.V.
- 23.10.2009; Leipzig: Flurnamenforschung in Thüringen – Auf dem Weg zu einer umfassenden Dokumentation; Namenkundliche Jahrestagung; Gesellschaft für Namenkunde
- 01.10.2009; Jena: Das Thüringer Flurnamenprojekt; Jenaer Flurnamensymposion 2009
- 22.09.2009; Bibra: Flurnamensammlung im Reinstädter Grund. Untersuchungen im Rahmen eines flurnamenkundlichen Projektseminars
- 29.08.2009; Bad Langensalza: Flurnamen als Quelle der Ortsgeschichtsforschung. Untersuchungen zum Flurnamenbestand der Gemarkung Langenssalza; Thüringer Heimattag 2009
- 11.02.09; Geunitz: Zur Erstellung eines Flurnamenbuches für die Gemarkungen Reinstädt, Geunitz und Zweifelbach. Untersuchungen im Rahmen eines Projektseminars
- 05.02.09; Jena: Flurnamenforschung an der FSU Jena; Zur Erstellung eines Flurnamenbuches für die Gemeinde Reinstädt
- 10.12.08; Rudolstadt: Einführung in die Flurnamensammlung
- 28.06.08; Weimar: Zum Stand der thüringischen Flurnamenforschung und weitere Aufgaben im Projekt „Flurnamen und Regionalgeschichte“
- 29.09.07; Bleicherode: Flurnamenforschung in Thüringen - Einführung in die Flurnamensammlung und zur Erstellung eines Flurnamenbuches für die eigene Gemarkung
- 25.08.07; Willroda/Erfurt: Flurnamenforschung in Thüringen - Einführung in die Flurnamensammlung und zur Erstellung eines Flurnamenbuches für die eigene Gemarkung
- 30.03.07; Jena: Zur Geschichte der Flurnamenforschung in Thüringen; Methodik des Sammelns, Arbeitsstand des Archivierens, Besichtigung des Archivs, Literaturhinweise
- 10.03.07; Meiningen: Flurnamenforschung in Thüringen - Einführung in die Flurnamensammlung und zur Erstellung eines Flurnamenbuches für die eigene Gemarkung
- 30.09.06; Weida: Flurnamenforschung in Thüringen - Einführung in die Flurnamensammlung und zur Erstellung eines Flurnamenbuches für die eigene Gemarkung
- 13.05.06; Bad Frankenhausen: Flurnamenforschung in Thüringen
-
Lehre
Sprachgeschichte: Einführung die historische Grammatik; Sprachgeschichte im Überblick; Mittelhochdeutsch; Frühneuhochdeutsch; Workshop: Einführung in die Sprachgeschichte des Deutschen; Geschichte des Deutschen III. Spätes Mittelalter und Frühe Neuzeit; Martin Luther und die Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache; Historische Dokumente finden, lesen und verstehen; Historische Korpuslinguistik; Sprachgeschichte von unten: Das Tagebuch der Olga Putschek aus dem Jahr 1881; Frauenschreiben zu Beginn des 20. Jahrhunderts - erforscht am Nachlass der Magdalene Trenkel (1894-1967); Historische Fachsprachen; Historische Dokumente und Digitalisierung
Onomastik: Dorf -Feld - Flur: Namenforschung im Kontext; Namenforschung im Kontext: Dokumentation und Analyse von Flurnamen im Reinstädter Grund; Namenforschung im Kontext: Dokumentation und Analyse von Flurnamen in Rothenstein/Oelknitz; Namenforschung im Kontext: Dokumentation und Analyse von Flurnamen in Camburg/Saale und den umliegenden Orten; Bleiche, Röste, Werg - Namen als Spiegel der Kulturgeschichte; Einführung in die Onomastik; Vorlesung Onomastik; Ortsnamen
Lexikologie: Einführung in die Lexikologie; Lexikologie und Semantik
Sonstiges: Wie stellt man (Frauen) aus? - Ein Projektseminar zur Konzeption einer Ausstellung zum Thema "Frauen in der Wissenschaft"; Wissenschaftliches Arbeiten in der Lehre vermitteln; Data Literacy