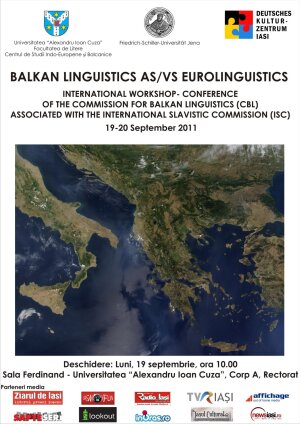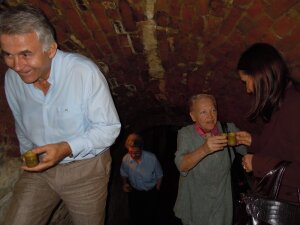Iasi 2011: Adrian Poruciuc guiding through the catacombs of Bolta rece.
Foto: Thede KahlBereits ein Jahr nach der Tagung der Internationalen Kommission für Balkanlinguistik in Wien im September 2010 war es dank der Initiative des rumänischen Sprachwissenschaftlers Adrian Poruciuc möglich geworden, eine weitere Tagung der Kommission in Iași/Rumänien durchzuführen. Die Tagung wurde von der „Facultatea de Litere“ und dem „Centrul de Studii Indo-Europene şi Balcanica“ der dortigen „Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena, vertreten durch Thede Kahl und dem Deutschen Kulturzentrum Iașidurchgeführt.
Poster of the conference in Iași 2011
Illustration: Commission for Balkan LinguisticsWaren in Wien die „Balkanismen“ das zentrale Thema, so ging es nun in Iași darum die Übereinstimmungen, aber auch die Unterschiede der Balkanlinguistik gegenüber der neuen sprachwissenschaftlichen Disziplin der „Eurolinguistik“ weiter zu beschreiben. Längst schon wurde das Konzept des Sprachbundes und der damit verbundenen Balkanismen als Terminus für die Gemeinsamkeiten der Balkansprachen in Frage gestellt und Ende des 20.Jahrhunderts auf die nicht zu übersehenden Übereinstimmungen der Balkansprachen mit anderen europäischen Sprachen hingewiesen[1]. Die Kommission für Balkanlinguistik beim Internationalen Slawistenkomitee war 1993 anlässlich des 11.Internationalen Slawistenkongreses in Bratislava begründet worden und konnte seitdem eine ganze Reihe wissenschaftlicher Tagungen durchführen, zuerst 1997 in Marburg mit der Behandlung aktueller Fragen der Balkanlinguistik, wo 1999 auch das Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft „Kleiner Balkansprachatlas“ angesiedelt werden konnte[2], dann 2002 in St.Petersburg mit einer ähnlichen Fragestellung und der Frage der Realisierung eines Balkansprachatlasses, 2002 in Sofia mit dem Thema der Gemeinsamkeiten m Vokabular der Balkansprachen, 2004 erneut in St.Petersburg mit der Behandlung der Frage kleiner ethnischer Gruppen auf der Balkanhalbinsel, 2006 in Belgrad mit dem Thema des romanischen Elementes auf der Balkanhalbinsel, 2008 in Berlin mit dem Thema „Innovationen in der Kontaktlinguistik der Balkanhalbinsel – Trends und Perspektiven“, 2009 in Veliko Tărnovo, wo das Verbalsystem der Balkansprachen – Erbe und Innovation das zentrale Thema war. In Wien war 2010 das Thema der Tagung „Balkanismen heute“.[3]
Rumänien hat nicht nur zahlreiche Verbindungen zu anderen südosteuropäischen Ländern, sondern hat auch selbst seit dem 19.Jahrhundert entscheidende Beiträge zur wissenschaftlichen Betrachtung nicht nur des Rumänischen, sondern auch zur Gesamtheit der Balkansprachen beigetragen. Genannt seien nur die bekannten Namen von Alexander Philippide, Sextil Puşcariu, Alexander .Rosetti, Alexander Graur und Iorgu Iordan. Aber auch Österreich und Deutschland kann auf eine reiche Tradition auf dem Gebiete der Rumänistik und Balkanistik zurückblicken, genannt seien nur die Namen von Franz Miklosich in Wien, Friedrich Diez in Bonn, Gustav Weigand in Leipzig, Ernst Gamillscheg und Günter Reichenkron in Berlin. Die 1860 gegründete Universität Ioan Cuza in Iași ist die älteste rumänische Universität und verfügt heute nicht nur über eine Rumnische und Slawistische Abteilung sowie ein Zentrum für Indoeuropäistik und Balkanstudien. Der Verlag der Universität Jaşi hatte 1999 auch eine Einführung in die Balkanlinguistik in rumänischer Sprache von Klaus Steinke und Ariton Vraciu veröffentlicht[4].
Dhori Qirjazi discovering the exit from the Bolta rece catacombs
Foto: Thede KahlFür die Diskussionen waren die folgenden Themen vorgesehen: genealogische, typologische und areale Sprachbetrachtung, Beiträge der Balkanlinguistik zur weiteren Entwicklung der Eurolinguistik, mögliche Beiträge der Balkanlinguistik zur Entwicklung der slawischen Sprachwissenschaft, Heimsprache vs. Verkehrssprache in Südosteuropa, Sprachinseln in Südosteuropa, Quellen für Neologismen in Südosteuropa und interdisziplinäre Zugänge zur „Europäizität“.
Die Tagung in Iași wurde als ein internationaler workshop durchgeführt und wurde nach der Begrüßung von Adrian Poruciuc mit der Darlegung der Ziele und Erwartungen der Tagung eröffnet, gefolgt von dem Vortrag von Helmut W.Schaller/Marburg zur Frage der Wechselbeziehung von „Balkansprachbund“ und „Baltoslawischer Sprachgemeinschaft“, verbunden mit der Fragestellung, ob es sich hierbei um gemeinsame sprachliche Merkmale eines Europäischen Sprachbundes handle. Stellt der „Sprachbund“ eine Gruppe von Sprachen dar, die durch typologische Merkmale, die bestens bekannten „Balkanismen“ miteinander verbunden sind, so bildet die „Sprachgemeinschaft“ eine auf genetischen Merkmalen basierende Übereinstimmung zwischen mindestens zwei Sprachen, so der prädikative Instrumental und der Genitiv bei verneinten Objekten in slawischen Sprachen und im Litauischen. Einen ganz neuen Aspekt der Balkanlinguistik eröffnete Thede Kahl/Wien-Jena mit seiner Darstellung der Entwicklung der grammatischen Terminologie, angefangen von den ersten Beschreibungen von Balkansprachen bis hin zu den gegenwärtigen normativen Grammatiken und der dort gebräuchlichen grammatischen Terminologie. Klaus Steinke/Erlangen-Krakau behandelte die Stellung des Rumänischen und Rumäniens zum Balkansprachbund. Erinnert wurde hier an die teilweise skeptische Haltung gegenüber dem Balkansprachbund, da Rumänien zwar zu Südosteuropa, aber nicht unbedingt zur Balkanhalbinsel gehört. Bereits Sextil Pușcariu hatte in seiner Darstellung der rumänischen Sprache, erschienen 1943 in deutscher Sprache, eine distanzierte Haltung zum Konzept des Balkansprachbundes eingenommen, das in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen von der Prager Schule unter Führung von Nikolaj Trubetzkoy, Roman Jakobson und Bohuslav Havránek entwickelt worden war.
Die Sektion „Wörter und Identitäten wurde von Victor Friedman geleitet, wo Todor Todorov/Sofia über die Etymologie zweier entlehnter Balkanwörter im Bulgarischen, nämlich „tekjasvam“ und „terk“ sprach, gefolgt von Corinna Leschber/Berlin mit Kriterien zur Analyse von Slavismen im Rumänischen. Bekanntlich machen slawische Elemente im Rumänischen einen beträchtlichen Anteil aus, die hier behandelte Frage drehte sich vor allem darum, ob bestimmte Dialektgebiete des Dakorumänischen besonders stark von Slawismen erfasst wurde, ob es sich dabei um Slawismen bulgarischen, serbischen oder auch ukrainischer Herkunft handelte. Krasimira Koleva/Šumen befasste sich mit sprachlichen Tatsachen, die für die sprachliche Identität der Goran-Enklave im Süden des Kosovo wichtig sind. Doris Kyriazis/Thessaloniki behandelte slawische Elemente in griechischen Idiomen Südalbaniens, wobei auch ausführlich auf die früheren Forschungen von Meyer (1891und 1894), Seliščev (1931), Vasmer (1941) u.a. einging. Adrian Poruciuc/Iași behandelte alte Germanismen auf der Balkanhalbinsel und in anderen Teilen Europas. Altgermanische Elemente in den Balkansprachen und im übrigen Europa wurden in langen Zeiträumen übernommen, so vom 2. Bis zum 7.Jahrhundert n.Chr., von Spanien bis Russland, von Finnland bis Italien und auch in den südslawischen Sprachen, ebenso im Rumänischen, Albanischen und Griechischen finden sich germanische Elemente. Victor Friedman spannte den Bogen von Europa, Eurasien nach Südostasien und warf die Frage einer Areallinguistik für das 21.Jahrhundert auf. Er wies darauf hin, dass über Europa hinausgehend nicht nur im Sinne von Trubetzkoy und Jakobson von einem Eurasischen Sprachbund gesprochen werden könne, sondern auch die Sprachen des Kaukasus, Süd und Südostasiens auch eine beachtenswerte Anzahl typologischer Übereinstimmungen aufweisen, die die Konzipierung von weiteren Sprachbünden möglich erschienen lassen. Jürgen Kristophson behandelte selten auftretende volkssprachliche Wörter im früheren Neugriechischen, Irena Sawicka/Torun stellte die Frage nach der Methodologie von Arealforschungen, Ina Arapi behandelte gemeinsame grammatische und lexikalische Elemente des Aromunischen, Rumänischen und Albanischen auf der Grundlage einer aktuellen aromunischen Grammatik. Für sie stellte sich die Frage, ob die von ihr behandelten Aromunen eine eigene vom übrigen Aromunischen abgesonderte Gruppe darstellten oder es sich vielleicht um eine romanisierte griechische Bevölkerung handle. Artur Karasiński behandelte syntaktische Methoden bei der Wortbildung anhand von albanischem sprachlichem Material.
Die Tagung in Iași hat deutlich gemacht, dass gerade jetzt, wo es um die europäischen Zusammengehörigkeit und Zusammenführung geht, die Betrachtung der südosteuropäischen Sprachen im Hinblick auf die Eurolinguistik weiter intensiviert werden muss. Die Universität Iaşi, mit ihrem Rektor Professor Dr.Vasile Ișan und ihrem Fachvertreter für die südosteuropäischen Sprachen, Prof.Dr.Adrian Poruciuc hat dankenswerterweise die Möglichkeit gegeben, für die gegenwärtigen und auch zukünftige Forschungen eine ausgezeichnete Möglichkeit für Vorträge und Diskussionen gegeben, die sich sicher auch in einem Sammelband, der in Iaşi für den Druck vorbereitet werden soll, niederschlagen werden. Die nächste Tagung der Kommission wird sich mit der Frage des germanischen Elementes auf der Balkanhalbinsel im nächsten Jahr in Göteborg/Schweden befassen. Für den XIV.Internationalen Slawistenkongress in Minsk/Weißrussland ist ein Pannel der Kommission für Balkanlinguistik vorgesehen, das das Thema „Ezikovi javlenija na granicata meždu dva areala“ behandeln wird.
[1] Vgl. Hierzu den Beitrag des Frankfurter Slawisten und Balkanologen Christo Vasilev: Balkanismen - Slavismen - Europäismen. In: Zeitschrift für Balkanologie 17, 1981, S.93-100. Ferner der erste größere Ansatz für die Begründung einer eurolinguistischen Sprachbetrachtung: Eurolinguistik. Ein Schritt in die Zukunft. Beiträge zum Symposion vom 24. Bis 27.März 1997 im Jagdschloß Glienicke (bei Berlin). Herausgegeben von Norbert Reiter. Wiesbaden 1999.
[2] Vgl. Hierzu Helmut W.Schaller (Herausgeber): Grundfragen eines Südosteuropasprachatlas. Geschichte, Problematik, Persektive, Konzeption, Methode, Pilotprojekt. Marburg 2001.
[3] Vgl. hierzu Helmut W. Schaller: A Concise Historical Presentation of the Commission of Balkan Linguistics (CBL) associated with the International Slavistic Commission (ISC). Translated from German by Adrian Poruciuc. In: Balkan Linguistcs as/vs Eurolinguistics. Programm der Tagung in Jaşi/September 2011.
[4] Introducere in lingvistica balcanica.
Helmut W.Schaller/Marburg a.d.L.