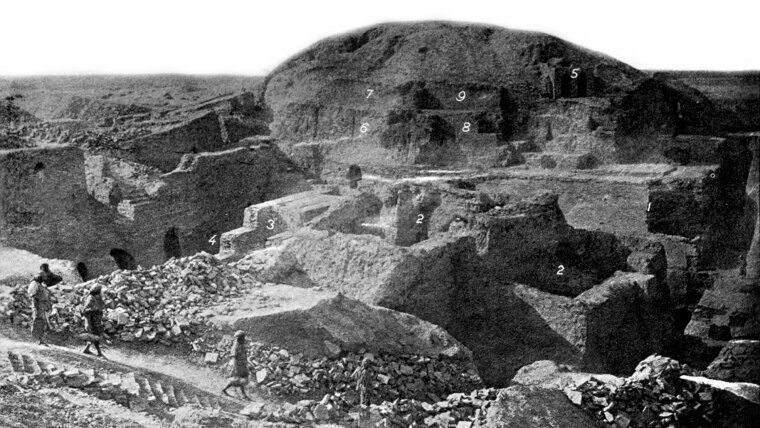
Nippur, der Standort des Enlil-Tempels und religiöses Zentrum des sumerischen Pantheons, spielte aufgrund seiner kulturellen, religiösen und politisch-ideologischen Bedeutung eine zentrale Rolle innerhalb der mesopotamischen Zivilisation. Diese herausgehobene Stellung lässt sich bereits seit der frühdynastischen Zeit anhand von Texten aus Fāra, Tell Abū Ṣalābīḫ und Nippur selbst nachweisen und war Gegenstand intensiver Forschung zu Religion, politischer Geschichte und Sozialökonomie, etwa im Kontext altbabylonischer Literatur und der umfangreichen mittelbabylonischen (kassitischen) Textüberlieferung des 2. Jahrtausends v. Chr.
Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass das 1. Jahrtausend – und insbesondere das lange 6. Jh. (626–484 v. Chr.), das als eine der am besten dokumentierten Perioden Babyloniens gilt – bislang kaum systematisch im Hinblick auf Nippur untersucht wurde. Während die neuassyrisch/früh-neubabylonische und die spätachämenidische Zeit gut erforscht sind, fehlt eine umfassende Analyse der Entwicklung Nippurs im langen 6. Jh. Das Projekt setzt hier an und verfolgt zwei Zielrichtungen:
- Synchron: Eine Analyse des verfügbaren Quellenmaterials im Vergleich zu überregionalen Entwicklungen im langen 6. Jh., um Nippurs Funktion jenseits der dominanten Babylon–Uruk-Achse zu konturieren.
- Diachron: Ein Abgleich der Befunde mit der Situation im 8. bzw. 5. Jh., insbesondere anhand des Statthalter- und des Murašû-Archivs, um langfristige Entwicklungen im Bereich der Verwaltung und Herrschaftsstruktur nachzuzeichnen.
Ziel ist folglich ein differenziertes Porträt Nippurs, das die Transformation von einer bedeutenden Garnisonsstadt des assyrischen Reichs über eine marginalisierte Stadt des 6. Jh. v. Chr. bis hin zu einem Dienstland-Knotenpunkt des Achämenidenreichs des 5. Jh. v. Chr. nachzeichnet. Aufbauend auf bestehenden Großprojekten, umfangreichen Datenbeständen und digitalen Methoden soll das Projekt neue Impulse zur Erforschung urbaner Dynamiken und der Eisenzeit Babyloniens liefern.
Projektlaufzeit: Beginn 01/26
Projektteam
-
Hackl, Johannes, Prof. Dr. Universitätsprofessor Lehrstuhl Altorientalistik
Raum D 307
Zwätzengasse 4
07743 Jena
Foto: Jürgen Scheere -
Levavi, Yuval, Dr. Wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl Altorientalistik
Kontakt

nach Vereinbarung